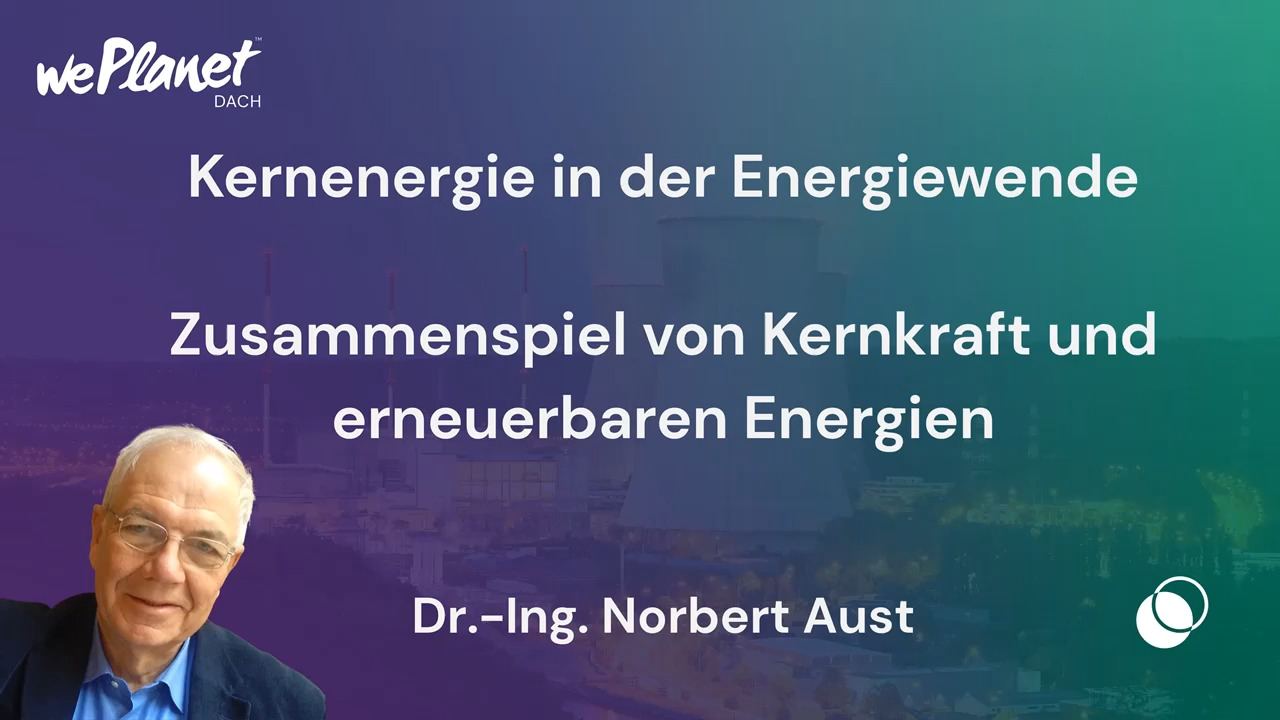Neue Proteine und biotechnologische Innovationen stehen an der Schwelle, unsere Ernährung grundlegend zu verändern. Doch welche Chancen und Herausforderungen bergen kultiviertes Fleisch und Präzisionsfermentation? Wir haben drei anerkannte Expertinnen und Experten um ihre Einschätzungen gebeten, um die aktuellen Entwicklungen und Zukunftsperspektiven dieser vielversprechenden Technologien zu beleuchten.

Ivo Rzegotta
Senior Public Affairs Manager beim Good Food Institute Europe. Er engagiert sich für günstige politische Rahmenbedingungen für pflanzenbasierte, kultivierte und fermentationsbasierte Lebensmittel in der DACH-Region.

Dr. Julius Che Ngwa
leitet die Forschungsgruppe für Kultiviertes Fleisch am Fraunhofer IME, wo er sich auf die Entwicklung von Zelllinien, Trägerstrukturen (Scaffolds) und Bioreaktoren für die Produktion von kultiviertem Fleisch konzentriert.

Dr. Arianna Ferrari
ist Philosophin am Center for Innovation Systems and Policy am AIT in Österreich. Sie forscht zu Prozessen der strategischen Vorausschau (Foresight), Zukunftsvisionen von Innovationen sowie zu Technik-, Umwelt- und Tierethik im Kontext neuer Technologien.
Aktuelle Herausforderungen
Welche technologischen, wirtschaftlichen oder politischen Hürden – einschließlich regulatorischer Aspekte – stehen derzeit einer breiten Markteinführung im Wege?
 Julius Che Ngwa:
Julius Che Ngwa: Skalierbarkeit bleibt eine erhebliche Herausforderung in der Produktion von kultiviertem Fleisch, beeinflusst durch mehrere Faktoren. Wesentliche Probleme sind der Mangel an effizienten Bioreaktoren und skalierbaren Trägerstrukturen (Scaffolds) für strukturierte Produkte. Obwohl einige serumfreie Medien verfügbar sind, erfordern sie weitere Verfeinerung und Kostensenkung, um ihre Anwendbarkeit zu verbessern. Aus wirtschaftlicher Sicht ist kultiviertes Fleisch derzeit teurer als konventionelles Fleisch, was seine Wettbewerbsfähigkeit oder seine Funktion als sinnvolle Ergänzung behindert. Eine Kostensenkung ist entscheidend für seine Marktfähigkeit. Politisch stellt die regulatorische Landschaft Hürden dar, da bisher nur wenige Länder, insbesondere Singapur und die USA, kultiviertes Fleisch für den Verkauf zugelassen haben. Die meisten Regulierungsbehörden sind noch dabei, Rahmenwerke zu entwickeln, was langwierige Genehmigungsverfahren mit sich bringt.
Skalierbarkeit bleibt eine erhebliche Herausforderung
Julius Che Ngwa
 Ivo Rzegotta:
Ivo Rzegotta:Nachhaltige Lebensmittel auf Basis von Pflanzen, modernen Fermentationasverfahren und der Kultivierung von tierischen Zellen haben zwei große Hürden zu bewältigen, bevor sie ihr Potenzial für den Klima- und Umweltschutz und auch für den Wirtschaftsstandort Europa ausspielen können. Zunächst muss die Produktion dieser Lebensmittel skaliert werden, so dass sie zu wettbewerbsfähigen Preisen hergestellt und verkauft werden können. Das ist eine technologische Herausforderung, aber auch eine wirtschaftspolitische Aufgabe. Denn für die Finanzierung großer Anlagen braucht es gänzlich neue Finanzierungsinstrumente. Und dann ist da noch die Zulassung: Es ist gut, dass wir in Europa die weltweit höchsten Anforderungen an die Lebensmittelheit haben, aber das bei der Umsetzung des Verfahrens zur Zulassung von neurartigen Lebensmitteln muss Europa noch effizienter und transparenter werden, damit wir da nicht im weltweiten Wettbewerb den Anschluss verlieren.
 Arianna Ferrari:
Arianna Ferrari:Alternative Proteine, insbesondere biotechnologisch hergestellte Produkte wie zellkultiviertes Fleisch, stehen aktuell vor mehreren technologischen, ökonomischen und politischen Hürden. Technisch sind viele Herstellungsverfahren noch nicht skalierbar: Es fehlen robuste, kosteneffiziente und nachhaltige Produktionsprozesse. Gleichzeitig sind viele Start-ups von großen Investitionen abhängig, insbesondere aus der klassischen Fleischindustrie oder großem Molkereikonzernen, was Fragen nach Monopolisierung und Abhängigkeit aufwirft. Es braucht dringend transparente, partizipative politische Rahmenbedingungen, um Innovationen nicht nur zu ermöglichen, sondern auch gemeinwohlorientiert zu gestalten.
Polarisierte Debatten
Wie nehmen Sie die gesellschaftliche Akzeptanz solcher Produkte wahr und was könnte das Vertrauen stärken?
 Julius Che Ngwa:
Julius Che Ngwa:Viele Menschen stehen kultiviertem Fleisch noch zögernd und neugierig gegenüber, wobei ein erheblicher Teil nicht weiß, was es eigentlich ist. Wenn ich erwähne, dass ich in diesem Bereich arbeite, bitten die meisten um eine Erklärung. Um Vertrauen und Akzeptanz zu fördern, ist es unerlässlich, die Öffentlichkeit über den Produktionsprozess von kultiviertem Fleisch aufzuklären. Darüber hinaus ist Transparenz bei der Kommunikation unserer Forschungsergebnisse entscheidend. Dadurch können wir Vertrauen nicht nur bei den Verbrauchern, sondern auch bei den Aufsichtsbehörden aufbauen.
 Ivo Rzegotta:
Ivo Rzegotta:Das Interesse an nachhaltigen Lebensmittelinnovationen ist hoch, sowohl in Deutschland als auch im übrigen DACH-Raum. So ist Deutschland der mit Abstand größte Markt für pflanzliche Lebensmittel, und 38 Prozent der Menschen in Deutschland sagen, dass sie künftig mehr pflanzliche Lebensmittel konsumieren wollen. Auch bei neuartigen Lebensmitteln wie kultiviertem Fleisch und fermentationsbasierten Lebensmitteln zeigen Umfragen regelmäßig, dass rund die Hälfte der Befragten zumindestens einmal probieren würde. Entscheidend für die Akzeptanz ist aber, dass wir sowohl bei den sensorischen Einschaften – Geschmack und Textur – als auch beim Preis mindestens Parität zu den tierischen Pendants erreichen. Und da bleibt noch viel zu tun für die Wissenschaft, für die Unternehmen und auch für die Politik, die dies mit öffentlicher Förderugn unterstützen sollte.
 Arianna Ferrari:
Arianna Ferrari:Momentan erlebe ich eine stark polarisierte Debatte. Auf der einen Seite stehen Skeptiker:innen, die – nicht selten gestützt auf Halbwissen oder Desinformation – alternative Proteine als „unnatürlich“ oder gar gefährlich ablehnen. Auf der anderen Seite stehen Technologie-Enthusiast:innen, die berechtigte Bedenken etwa zu Gerechtigkeit, Marktkonzentration oder Tierethik als irrational abtun. Beide Seiten sprechen oft aneinander vorbei – während die breite Bevölkerung kaum aktiv eingebunden wird.
Es braucht dringend transparente, partizipative politische Rahmenbedingungen
Arianna Ferrari
Was das Vertrauen massiv untergräbt, ist die Art und Weise, wie viele Anbieter derzeit vorgehen: Statt auf offene Kommunikation zu setzen, verfolgen sie eine Strategie der „stillen Einführung“ – möglichst wenig Kontroverse, möglichst schnelle Marktpräsenz. Diese technokratische Logik ist gefährlich. Denn sie umgeht genau jene gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse, die notwendig wären, um solche tiefgreifenden Innovationen demokratisch zu legitimieren.
Vertrauen entsteht nicht durch Hochglanz-Marketing oder optimistische Versprechen. Vertrauen entsteht durch Transparenz, ehrliche Debatten – und vor allem durch die Bereitschaft, die Öffentlichkeit nicht nur als Konsument:innen, sondern als politische Mitgestalter:innen eines neuen Ernährungssystems ernst zu nehmen. Genau das fehlt derzeit – und das muss sich dringend ändern.
Innovationsmotoren
Welche Akteure wie Startups, Forschungseinrichtungen oder Investoren treiben die Entwicklung voran?
Wo hakt es Ihrer Meinung nach?
 Julius Che Ngwa:
Julius Che Ngwa:Unternehmen wie Upside Foods und Good Meat verkaufen bereits kultiviertes Hühnerfleisch in den USA und Singapur. Mosa Meat aus den Niederlanden, Pioniere des ersten Laborburgers, hat einen Zulassungsantrag für ihr kultiviertes Rinderfett in der EU eingereicht. Auch Forschungseinrichtungen wie die Tufts University und die Maastricht University leisten wichtige Beiträge. Der größte Engpass für Investitionen ist jedoch die regulatorische Unsicherheit, die aus langen Genehmigungsverfahren oder dem Fehlen klarer Zulassungswege resultiert.
 Ivo Rzegotta:
Ivo Rzegotta:Im DACH-Raum haben wir ein vielfältiges und leistungsstarkes Ökosystem für alternative Proteine, sowohl in kommerzieller als auch in wissenschaftlicher Hinsicht. Wir haben viele innovative Startups, die diese neue Technologien vorantreiben. Einige davon sind in ihrem Bereich führend in Europa, zum Beispiel Formo bei tierfreiem Käse oder Bluu Seafood bei kultivierten Fisch.
Im DACH-Raum haben wir ein vielfältiges und leistungsstarkes Ökosystem für alternative Proteine
Ivo Rzegotta
Gerade im Hinblick auf moderne Fermentationsverfahren ist der DACH-Raum ein Vorreiter. Hinzu kommt im DACH-Raum, dass viele Industrieunternehmen und etablierte Lebensmittelhersteller in diesen Markt eintreten, sei es als Investor von Startups oder als Zulieferer von Fermentern und anderen Vorleistungen. Beispiele hierfür sind unter anderem die Lebensmittelhersteller PHW-Gruppe und InFamily Foods, die sich von Fleischunternehmen in breit aufgestellte Proteinunternehmen weiterentwickelt haben, und Handelsunternehmen wie REWE und Migros, die in den Bereich investieren. Vervollständigt wird das Ökosystem im DACH-Raum durch starke Forschungseinrichtungen, wobei sowohl Universitäten an alternativen Proteinquellen arbeiten sowie auch außeruniversitäte Forschungseinrichtungen wie diverse Fraunhofer-Insttitute.
 Arianna Ferrari:
Arianna Ferrari:Derzeit wird die Entwicklung alternativer Proteine maßgeblich von privaten Investitionen großer Konzerne und Risikokapitalgeber:innen vorangetrieben. Viele der innovativen Impulse stammen zwar aus engagierten Start-ups, doch ohne Zugang zu Kapital und Infrastruktur sind diese auf Investoren angewiesen – oft ausgerechnet auf jene Unternehmen, die bislang mit industrieller Tierhaltung erhebliche Profite erzielt haben. Das ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer kapitalgetriebenen Innovationspolitik, die technologische Lösungen vorantreibt, ohne die grundlegenden strukturellen und ethischen Fragen unseres Ernährungssystems zu stellen. Genau hier muss Politik eingreifen – nicht nur als Regulierungsinstanz, sondern als gestaltende Kraft, die diese Transformation offen, demokratisch und gemeinwohlorientiert rahmt.
Politische Stellschrauben
Wenn Sie einen politischen Hebel bewegen könnten, um diese Technologien zu fördern, welcher wäre das?
 Julius Che Ngwa:
Julius Che Ngwa:Ich würde den regulatorischen Weg für die Zulassung alternativer Proteine, insbesondere von kultiviertem Fleisch, standardisieren und beschleunigen. Eine Straffung dieses Prozesses würde die Markteinführung dieser Produkte beschleunigen, die Verbraucher von ihrer Sicherheit überzeugen und Investitionen in diesem Bereich fördern.
 Ivo Rzegotta:
Ivo Rzegotta:Den einen Hebel gibt es nicht, sondern es braucht eine umfassende Strategie für alternative Proteine in Deutschland, in der alle Aspekte mitgedacht werden. Die neue Bundesregierung sollte eine solche nationale Roadmap für den Markthochlauf entwickeln, in der alle Themen adressiet werden (bestehende Forschungslücken, effiziente und verlässliche Zulassung, Skalierung der Produktion, Rolle der Landwirtschaft) und alle Akteure mitgenommen werden (Ministerien für Landwirtschaft, Forschung, Wirtschaft und Umwelt sowie Stakeholder aus den Bereichen Lebensmittelwirtschaft, Landwirtschaft und Handel). Diese Strategie sollte verbindlich darlegen, wo Deutschland bis 2030 bei dem Thema sein will und welche Maßnahmen es braucht, um dieses Ziel zu erreichen.
 Arianna Ferrari:
Arianna Ferrari:Die Entwicklung alternativer Proteine wird zwar von innovativen Start-ups initiiert, aber sie ist stark kapitalgetrieben: Große Agrar- und Lebensmittelkonzerne sowie Venture-Capital-Fonds investieren massiv – oft mit dem Ziel einer schnellen Rendite. Diese Marktdynamik birgt das Risiko, dass Profitinteressen Vorrang vor Gemeinwohlzielen bekommen. Trotz öffentlicher Rhetorik von Nachhaltigkeit und Tierwohl dominieren Geschäftsmodelle, die intransparente Prozesse und patentierte Verfahren favorisieren. Das Vertrauen in die Branche lässt sich daher nicht durch Marketingkampagnen oder oberflächliche Transparenz-Labels gewinnen. Was es braucht, ist echte Beteiligung: Bürger:innen müssen schon in der Frühphase von Forschung und Entwicklung mitreden dürfen.
Bürger:innen müssen schon in der Frühphase von Forschung und Entwicklung mitreden dürfen.
Arianna Ferrari
Was dabei oft zu kurz kommt, ist die eigentliche Frage: Wie wollen wir uns als Gesellschaft künftig ernähren? Welche Rolle sollen Tiere in der Landwirtschaft noch spielen? Und wie schaffen wir ein Ernährungssystem, das ökologisch tragfähig, gerecht (auch für Tiere!) und gesund ist? Solange diese Debatten nicht offen und inklusiv geführt werden, besteht die Gefahr, dass biotechnologisch erzeugte „alternative“ Proteine letztlich lediglich bestehende Konsummuster zementieren – anstatt zu transformieren.
Herzlichen Dank für das Interview!
Hat dir der Artikel gefallen?
Wir sind eine noch junge Klima-NGO, die neue Wege gehen will, vieles ist noch im Aufbau: Bitte unterstütze uns und unsere Arbeit, es gibt dafür viele Wege:
– Nimm Kontakt auf und werde selbst aktiv,
– folge uns auf Social Media, zB auf X,
– oder abonniere unseren NEWSLETTER und bleibe über uns informiert!
… und natürlich freuen wir uns riesig über Spenden: Einfach auf den Button rechts klicken!